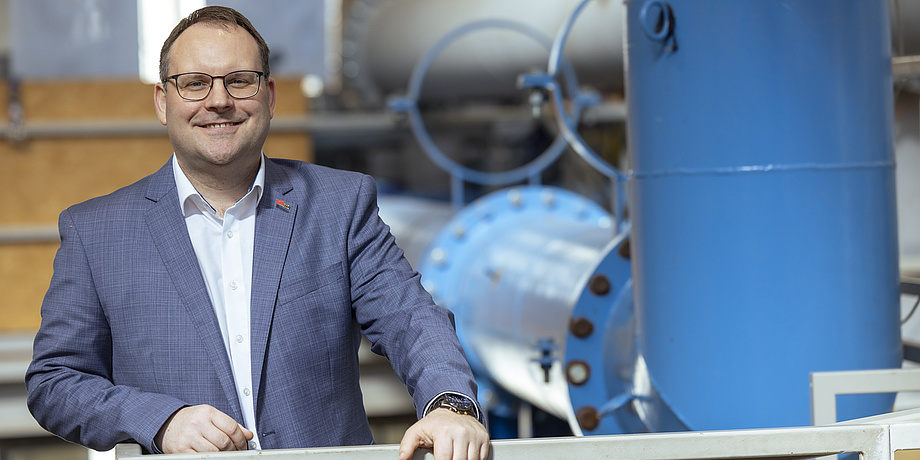News+Stories: Sie haben bereits an der TU Graz studiert und sind nach Auslandsaufenthalten wieder zurück. Haben Sie sich gut eingelebt?
Stefan Haun: (lacht) Ganz wunderbar. Ich kenne einige Kolleg*innen schon aus meinem Studium und von Projekten - es ist also nicht alles neu und man hat mich sehr gut aufgenommen.
Sie leiten seit Anfang des Jahres das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft Haben Sie Pläne, wohin sich das Institut in den kommenden Jahren entwickeln soll?
Stefan Haun: Bisher war der Schwerpunkt am Institut der konstruktive Wasserbau. Also Talsperren und die Stromerzeugung aus Wasserkraft. Das wird auch weiterhin ein sehr wichtiges Thema sein, aber ich möchte die Forschungsgebiete ausweiten. Ich komme vor allem aus dem Bereich Sedimenthydraulik und Renaturierung von Flusslandschaften. Diese Bereiche möchte ich nun intensivieren.
Welcher Weg hat sie quasi ans Wasser geführt?
Stefan Haun: Ich selbst habe an der TU Graz Bauingenieurwesen studiert - würde ich heute beginnen, hätte ich mich sicher wieder für den Master Geotechnical and Hydraulic Engineering entscheiden. Damals habe ich mich insbesondere für Tunnelbau und Felsmechanik interessiert. Die allerletzte Vorlesung hat mich dann aber quasi „getriggert“. Es ging darin um den Flussbau und die Sedimenthydraulik. Da habe ich dann den Schwerpunkt gewechselt.
Die richtige Entscheidung?
Stefan Haun: Definitiv. Wegen dieses Themas bin ich dann auch in der Wissenschaft geblieben und nicht den klassischen Weg eines Bauingenieurs auf eine Baustelle gegangen. Ich habe mich während meiner Promotion in Norwegen mit der Sedimentation von Stauräumen beschäftigt.
Was ist denn das?
Stefan Haun: In Stauräumen lagern sich durch die reduzierte Bewegung des Wassers kleine und große Partikel ab. Wir sprechen davon, dass rund ein Prozent des weltweit verfügbaren Stauraumvolumens pro Jahr verlandet und damit verloren geht. Dem begegnet man mit dem Bagger und mit Stauraumspülungen.
Stauraumspülungen sind ja nicht ganz unumstritten, wenn man die Ökologie betrachtet…
Stefan Haun: Das stimmt. Aber wenn man diesen Prozess richtig plant, durchführt und überwacht dann kann das auch ökologisch vertretbar gemacht werden.
Was genau passiert da?
Stefan Haun: Im Grunde genau das, was man sich vorstellt: Das Wasser aus dem Staubecken wird abgelassen. Dabei erhöht sich die Sohlschubspannung an der Sohle des Staubeckens und Sedimente werden vom Wasser erodiert. Vor allem machen wir das bei Hochwasser, weil die Sohlschubspannungen besonders hoch sind, dadurch viele Sedimente mitgenommen werden und auch der Verdünnungseffekt groß ist. Bei der Spülung ändern sich die Schwebstoffkonzentrationen und der Sauerstoffgehalt im Unterlauf des Flusses und können den Lebensraum schädigen. Deshalb müssen wir genau planen und überwachen.
Es geht da ja nicht um einzelne Steine oder Partikel, sondern um sehr viele, sehr unterschiedliche Dinge, die noch dazu unter Wasser liegen und dadurch schwer betrachtet werden können. Wie kann ich diesen Prozess modellieren?
Stefan Haun: Es braucht extrem komplexe mathematische Modelle, die es derzeit noch nicht gibt. Kohäsive und rollige Sedimente verhalten sich zum Beispiel total unterschiedlich und es kommt zu spannenden Effekten. Noch dazu ist jeder Stauraum und jedes Gewässer anders und es gibt kein Pauschalrezept. Derzeit arbeiten wir in Flüssen oft mit empirischen Studien und daraus abgeleiteten Formeln - unter anderem auch mit Geschiebetransportformeln aus der Schweiz, wo es sehr ähnliche Flusslandschaften wie in Österreich gibt. Banal gesagt haben Forschende Partikel in eine Rinne gelegt, dass Wasser aufgedreht und geschaut wann und wie viele Steine sich bewegen. Nimmt man diese Formeln her und wendet sie auf die Realität an, hat man plötzlich 100- bis 1000-mal so viele Partikel die miteinander interagieren. Sie „verstecken“ sich auch hintereinander oder kleben zusammen. Wenn sich dann ein Partikel zu bewegen beginnt, bewegen sich auf einmal ganz viele Partikel. Die Partikel sind auch unterschiedlich schwer und werden deshalb auf verschiedene Weise im Wasser transportiert. Oft kommen noch biologische und chemische Prozesse hinzu. Es ist daher schwer vorherzusagen, wie sich die Ablagerungen im Stauraum als ein System verhalten werden.
Ich stelle es mir auch sehr schwer vor, solche Berechnungen in der Realität nachzuprüfen. Der Untersuchungsgegenstand liegt ja vollständig unter Wasser und wenn man das Wasser ablässt, hat sich der Boden ja alleine dadurch bereits verändert.
Stefan Haun: Ja genau - jede Messung im Fluss oder beim Ablassen des Stauraums verändert das System. In einem Projekt haben wir ungestörte Sedimentkerne aus 40 Meter Tiefe gezogen. Wir haben dafür eine Art Lot mit Plexiglasröhre verwendet, die sich beim Heben selbst verschlossen hat. So haben wir sowohl Sedimente aus der Sohle als auch Tiefenwasser entnehmen und untersuchen können. Aber auch Geschiebemessungen an der Sohle von Flüssen sind nicht trivial. Dazu verfassen wir gerade ein Merkblatt für die Praxis.
Dies sind aber alles sehr lokale Phänomene, muss man hier nicht größer denken?
Stefan Haun: Sehr wichtig ist mir, dass wir nicht nur den Stauraum, sondern das ganze System Fluss betrachten. Das muss interdisziplinär geschehen und ist unheimlich wichtig, um das große Ganze inkl. Ökologie und Bauwerke zu verstehen. Wir untersuchen die Hydrologie, die Zusammensetzung der Oberflächen, die Bodenerosion, die Gewässer und so weiter. Dieser holistische Blick wird im Wasserbau immer stärker gebraucht.
Zu dieser Betrachtung gehört natürlich auch die Verbauung unserer Flüsse, die vor allem in den vergangenen Jahrzehnten passiert ist.
Stefan Haun: Richtig. Es wurden da sehr viele Bausünden begangen, Flussläufe begradigt, Ufer verbaut und viele Flüsse regelrecht eingesperrt. Man hat es damals aber auch nicht besser gewusst. So haben wir zwar viel Fläche u.a. für die Landwirtschaft bekommen, aber den Fluss auch wesentlich schneller gemacht und uns teilweise selbst Hochwasserprobleme geschaffen. Im Zuge der Renaturierung versuchen wir, das wieder zurück zu bauen und den Fluss machen zu lassen, was er will. Wir geben ihm dabei vielleicht eine Initialzündung, aber danach darf er sich ganz natürlich entwickeln. Allerdings müssen wir ihn dabei genau überwachen, um zu vermeiden, dass er zu nahe an bewirtschaftete Flächen oder gar Siedlungen herankommt, wo wir dann wieder eingreifen müssen. Zusätzlich wird die Hochwassergefahr auch gesenkt, wenn der Fluss abseits von bewohnten Flächen Platz hat, um sich zu verbreiten – wir schaffen also natürlichen Retentionsraum, an denen er bei Hochwasser ungefährlich über die Ufer treten kann.
Das große Problem dabei ist die Grundstücksverfügbarkeit für solche Projekte. Und natürlich ist es auch nicht einfach Felder oder Wiesen bereitgestellt zu bekommen die bei Hochwasser überschwemmt werden. Hier gibt es noch viel Arbeit für uns, um im Sinne des Allgemeinwohles zu handeln.