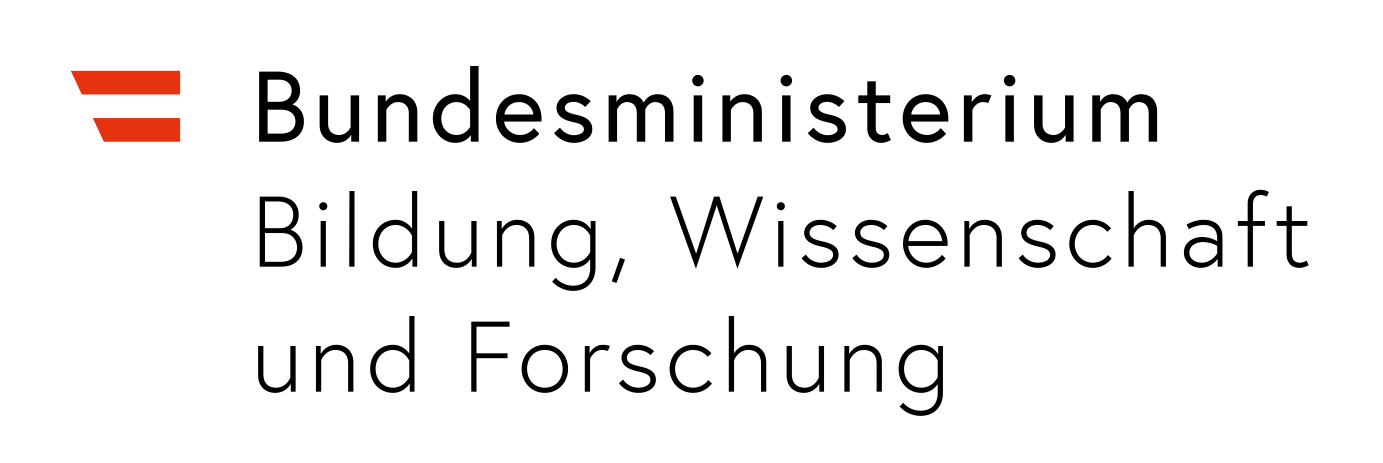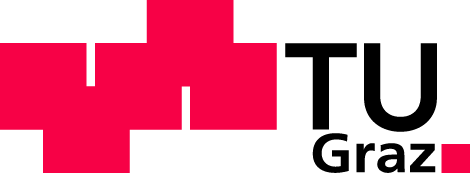Ein Blick in die Sessions
Projekte der kollaborativen Softwareentwicklung sind die Raketen, mit denen wir Richtung Hochschule der Zukunft reisen. Was aber brauchen wir, damit die Raketen abheben und an ihrem Ziel angelangen? Um diese Frage zu beantworten, konnten sich die Teilnehmenden am ersten Tag in einem individuell zusammengestellten Session-Dreiklang mit jeweils zwei Slots Input holen und ihre eigenen Erfahrungen einbringen.
Was geschah ...
in der Session: Kollaboration?
Johann Wilfling und Maximilian Petrasko widmeten sich in ihrem Slot der Frage, wie Kooperation gelingen und was die Wartung sowie den Betrieb von gemeinsamen Anwendungen erschweren oder erleichtern kann. Neben Erfahrungen aus bestehenden Kooperationen wurde der Begriff „Shared Services“ aufgegriffen und auch diskutiert. Es stellte sich heraus, dass bereits die Begriffsklärung eine Herausforderung darstellte, was wiederum die Notwendigkeit eines Austausches sichtbar machte. Dafür brauche es Offenheit, aber auch ein gewisses Ausmaß an Sicherheit müsse für alle Beteiligten gegeben sein. Gegenseitiges Vertrauen sei hier ausschlaggebend, weshalb dem auch nach Ansicht von Johann Wilfling ein Absatz im Kooperationsvertrag zugestanden werden könne. Dafür brauche es keine 100 Seiten – eine Zusammenarbeit sei auch auf Basis eines „dünnen“ Papiers möglich, in dem Grundsätze der Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen festgeschrieben sind. Kompromisse und Konsens müssen dabei nicht immer das Ziel sein: Eine Win-Win-Situation zu schaffen, kann durchaus angestrebt werden. Perfektion von Beginn an ist kein muss: Weile statt Eile – dies könne man auch gegenüber Entscheidungsträger*innen und Universitätsangehörigen argumentieren: Umso größer ein Projekt angesetzt ist, umso mehr Kraft und Weile erfordere es, dieses in Bewegung zu setzen. „Flugzeugträger lassen sich auch nicht so schnell wenden“ wie es einer der Sessionleiter formulierte.
in der Session: Methoden?
Diese Meinung teilten auch die Vortragenden der Session zu Methoden in der kollaborativen Software-Entwicklung. Was jedoch bereits Anfang ein bisschen schneller gehen könne, war laut Sessionleitung Nicole Bier das Thema Design Thinking. Sie stellte die Methode des Design Sprints vor und präsentierte, wie dies besonders in der Vorprojektphase effektiv genutzt werden könne, um schneller einen ersten und vor allem userorientierten Prototypen zu erhalten. Die Teilnehmenden zeigten großes Interesse an der Workshopmethode, welche die Erstellung des Produkt-Prototypen innerhalb von vier Tagen zum Ziel hat, stellten Fragen und brachten auch ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Auch hier wurde betont: Vertrauen und eine nicht an Perfektion orientierte Erwartungshaltung sind zentral für das Gelingen eines Design Sprints und die spätere Umsetzung des Projekts.
Auch der Folgeslot mit Michaela Schaitl und Sarah Pötzelsberger zu User Centered Design und User Testing regte die Teilnehmenden dazu an, sich mit Bedarfs- und Kund*innenorientierung auseinanderzusetzen und die Praxisberichte der Sessionleiter*innen mit eigenen Erfahrungen zu ergänzen. Mehrmals zum Thema gemacht wurde in beiden Slots die Zusammenarbeit mit Fachabteilungen und wie man diese dazu bringen könne, Prozesse zu überdenken und neu zu definieren – insbesondere, wenn bereits ein „Leidensdruck“ besteht. Auch wenn die Sessionleitungen hierfür natürlich kein Patentrezept liefern konnten, einen Rat konnten sie den Teilnehmenden geben: Die Betroffenen nicht nur in der Testphase, sondern von Anfang an miteinbeziehen. Das bedeutet, die User*innen dazu einladen, selbst Hindernisse im Prozess zu erkennen, Vorschläge zu machen und das Endprodukt an den User*innen auszurichten. Auch wenn das bedeutet, bereits erarbeitete Lösungsstrategien ad acta zu legen, frei nach dem Motto „Kill your darlings“.
in der Session: Softwareentwicklung & Organisation?
Design Thinking und die Miteinbeziehungen der Fachabteilungen fanden auch in der Session zu Softwareentwicklung & Organisation Erwähnung. Christian Marzluf erläuterte seine Vision einer Integration hoch drei: ein persönliches digitales Erlebnis, in dem Kernprozesse der universitären IT miteinander verbunden werden. Diese Gestaltung könne nur über einen Gestaltprozess erreicht werden, in dem Nutzer*innenorientierung im Vordergrund steht. Fachabteilungen dürften dabei genauso wie Studierende nicht übergangen, sondern müssten von Anfang an abgeholt werden. Bei der Integration der Systeme auf künstlicher Intelligenz zurückzugreifen sei nur anzuraten.
Wolfgang Spreicer und Stephan Prechtl widmeten sich in ihrem Slot der Agilen Softwareentwicklung und deren Vorteile für interuniversitäre Kooperationen. Denn: Mehr beteiligte Universitäten bedeute mehr personelle Ressourcen, um die Masse an Anforderungen zu bewältigen, die Softwarekooperationen mit sich bringen. Agilität bedeutet in diesem Falle, das Wissen und Rollen zu verteilen und österreichweit an einem Problem zu arbeiten, statt an jeder Hochschule separat an einer Lösung zu tüfteln. Wieder wurden Vertrauen und auch Mut als Stichworte genannt: Am besten sei es, Projekte als Teile einer Reise zu sehen, auf der hundertprozentige Sicherheit nicht immer garantiert werden kann: 96 Prozent reichen am Ende meist aus, gab die Sessionleitung mit einem Schmunzeln an die Teilnehmenden weiter.
Zwei Tage – ein Bild
Wie schon bei unserer letzten Konferenz war Graphic Recorder Robert Six im Einsatz. Die Metapher der Projektrakete, mit der man zur Hochschule der Zukunft aufbricht, zog sich durch die ganze Veranstaltung und bildete auch die Basis für das Stimmungsbild, das am Ende entstand. Das Besondere: Den Input lieferten diesmal die Teilnehmenden. Auf einer Pinnwand konnten diese über beide Tage verteilt ihre Gedanken, Assoziationen und natürlich auch ihre Erkenntnisse aus den Sessions und dem Open Space anbringen.
Machen Sie sich ein Bild davon, welchen Treibstoff die Teilnehmenden wählen, was ihre Erwartungen an ein gelungenes Projekt sind, wie Kommunikation funktionieren und Teamgeist aufgebaut werden kann und welche Gefahren die Rakete von ihrem Kurs abbringen könnte:
Welche Bauteile wir aus den Sessions mitnehmen
Eine für alle Hochschulen adäquate Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für erfolgreiche Software-Kollaborationen gibt es nicht. Ein paar Werkzeuge können wir aus Exploring Tomorrow aber schon einmal mitnehmen:
- Mut: Egal ob wir uns konkret mit der Integration von Prozessen beschäftigen, im Design Sprint einen ersten Prototyp erstellen oder vor dem Beginn einer interuniversitären Kooperation stehen: Es braucht Mut, Dinge auszuprobieren
- Perfektionismus zu Beginn ist kein Muss: Für ein neues Tool von Beginn an Perfektion anzustreben blockiert. Lieber Schritt für Schritt an die Sache herangehen und Fehler zuerst in Kauf nehmen, aus denen man für Versuch Nummer 2 lernen kann.
- Nutzen- und User*innenorientierung: Alle Beteiligten sollten sich einige sein, warum ein Projekt initiiert wird und für wen ein konkreter Nutzen entsteht. Die User*innen Experience sollte dabei stets an erster Stelle stehen. Besteht bei einer Nutzer*innengruppe wie den Fachabteilungen bereits ein Leidensdruck, gilt es, die Nutzer*innen einzuladen, bestehende Prozesse zu überdenken, selbst Hindernisse zu erkennen und zur Lösungsfindung beizutragen.
- Vertrauen: Universitäten, ob klein oder groß, haben zumeist mit denselben Problemen zu kämpfen. Wir alle wollen mit unseren Raketen in Richtung Hochschule 4.0 starten. Wie wäre es, wenn wir uns Vertrauen schenken und statt in vielen kleinen, in einer großen Rakete durchstarten? So brachte es auch ein Teilnehmender beim Nachmittagskaffee treffend zum Ausdruck:
„Wenn wir als Universitäten einander nicht vertrauen, wem denn dann?“